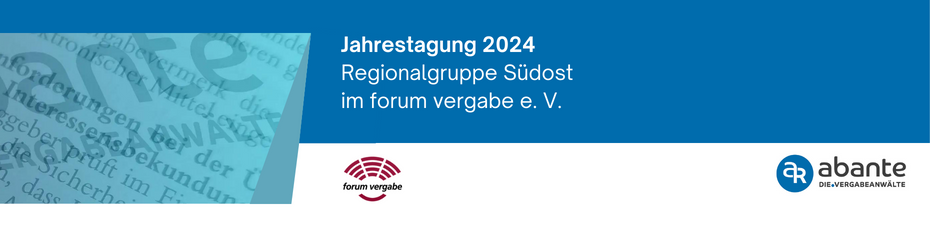Während der Vorbereitung auf ein Vergabeverfahren, wird dem öffentlichen Auftraggeber eine Analyse des Marktes empfohlen, um einen weitreichenden Überblick über die am Markt verfügbaren Angebote zu bekommen. So kann man einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs erzielen und allen Bietern die gleichen Chancen einräumen. Wichtig ist daher, ausreichend Gründe vorzuweisen, welcher Hersteller die Vorstellungen des Auftraggebers bestmöglich umsetzen kann. Bei einigen Auftraggebern spielt die Direktvergabe eine große Rolle. Hierbei verhandelt man mit nur einem Bieter. Dies könnte allerdings bei Nachprüfungsinstanzen zu schwerwiegenden Folgen führen und eine Art Diskriminierung, den anderen Bietern gegenüber, hervorrufen.
Jetzt unser Video zur Markterkundung auf dem YouTube-Kanal von abante Rechtsanwälte anschauen:
Was genau ist eine Markterkundung und wie läuft sie ab?
Es gibt keine genaue Vorgabe, wie eine Markterkundung durchgeführt wird. Man kann lediglich sagen, dass man bei einer Markterkundung relevante Informationen für Beschaffungsgegenstände (Waren, Güter, Leistungen) recherchiert, sammelt und dokumentiert. Somit können die ermittelten Angebote des bestehenden Marktes der Kalkulation des Auftraggebers zugrunde gelegt werden, um Ausschreibungen bestmöglich auf die Beschaffungswünsche der öffentlichen Auftraggeber anpassen zu können.
In den meisten Fällen wird eine Markterkundung vor einem Vergabeverfahren durchgeführt. Bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens ist strengstens zu beachten, dass es sich nicht nur um eine Kosten- und Preisermittlung zum Zwecke der Markterkundung handelt. Ansonsten ist dessen Durchführung unzulässig.
Außerdem darf eine Markterkundung nicht mit einer Beschaffung verwechselt werden. Daher ist es essentiell, die Unverbindlichkeit der Erkundung von vornherein klar zu kommunizieren und währenddessen eine Dokumentation zur Absicherung zu führen. Es ist wichtig, die Schwelle zu einem Vergabeverfahren nicht ungewollt zu überschreiten. Sich Informationen einzuholen ist kein Problem, wenn dabei nicht ein Auftrag erteilt wird oder konkrete Verhandlungen stattfinden. Dies soll einen Wettbewerbsvorteil zugunsten eines bestimmten Bieters verhindern.
Warum führt man überhaupt eine Markterkundung durch?
Prinzipiell ist es für den Auftraggeber wichtig, sich die Vor- und Nachteile verschiedener Produkte einzuholen und diese gewissenhaft zu vergleichen, um ein passendes Angebot zu erzielen. Diese Informationen können vom Auftraggeber im Internet recherchiert oder auch direkt bei Unternehmen angefragt werden. Wichtig ist dabei, sich den Rat von unabhängigen Sachverständigen, Behörden, etc. einzuholen, um eine Diskriminierung der Bieter auszuschließen. Es gibt viele Gründe, die für eine Markterkundung sprechen.
Eine Markterkundung ist unter anderem sehr sinnvoll für die Bestimmung des Beschaffungsbedarfs. Wie genau dieser Bedarf definiert wird, ist immer abhängig von den Vorstellungen der jeweiligen Auftraggeber selbst. Dabei gilt es für den Auftraggeber, die Auftragsgegenstände ausführlich und eindeutig zu beschreiben, um die Angebote der Bieter bestmöglich miteinander zu vergleichen.
Des Weiteren hilft die Markterkundung bei der Erstellung der Vergabeunterlagen. Nicht nur das Abfassen einer Leistungsbeschreibung kann hierdurch vereinfacht werden, ebenso können die maßgeblichen Eignungskriterien der am Verfahren zu beteiligenden Unternehmen ermittelt und festgelegt werden.
Darüber hinaus soll durch die Analyse des Marktes, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt werden. Dies gelingt durch die Bestimmung von Zuschlagskriterien, wie beispielsweise Qualität, Preis, Rentabilität, technischer Wert, etc.
Ein weiterer Grund ist die Auftragswertschätzung. Hierbei wird festgestellt, ob der Auftragswert oberhalb des Schwellenwerts (EU-Vergaberecht) oder unterhalb des Schwellenwerts (nationales Vergaberecht) liegt. Anhand der zu erwartenden Gesamtvergütung wird der Auftragswert der zu beschaffenden Leistungen geschätzt.
Zu guter Letzt sollte man noch erwähnen, dass eine Marktanalyse ebenfalls zur Ermittlung der richtigen Vergabeverfahrensart und des möglichen Bewerber- und/oder Bieterkreises wichtig ist.
Pflicht oder keine Pflicht?
Ob es eine Pflicht zur Markterkundung gibt oder nicht, ist in der Rechtsprechung insbesondere dann sehr umstritten, wenn der Auftraggeber hersteller‑, verfahrens- oder produktspezifisch ausschreiben will.
Auf der einen Seite beschlossen das OLG Rostock und das OLG Düsseldorf, keine Pflicht zur Markterkundung anzunehmen. Auf der anderen Seite, haben das OLG Jena, das OLG Celle und die VK Niedersachsen gegenteiliges entschieden. Sie sind der Meinung, dass es essentiell ist, sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen und schlussendlich die Entscheidung auf dieser Grundlage ausführlich zu dokumentieren.
Die wohl herrschende Meinung verlangt nicht, dass der Auftraggeber vor einer Auftragsspezifikation Markterkundungen oder Marktanalysen mit dem Ziel durchführt zu erforschen, ob andere Produkte in Frage kommen oder „ob andere – alternative – technische Lösungsansätze denkbar sind“. Soll allerdings ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden, sind aufgrund der besonderen Begründungserfordernisse für die Wahl dieses Verfahrens strengere Anforderungen zu stellen, wonach grundsätzlich eine Markterkundung durchzuführen ist. Es gilt insoweit die Effizienzeffekte des freien Marktes zu nutzen, um weitreichend über Alternativen der Produkte Bescheid zu wissen. Es kann jedoch zu einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb kommen, bei dem keine Pflicht zur Markterkundung erforderlich ist. Dies geschieht unter außergewöhnlichen Umständen, bei denen keine Alternativen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands vorliegen.
Grundsätzlich besteht zwar keine normierte Pflicht für eine Markterkundung, sie sollte gleichwohl vor Einleitung eines Vergabeverfahrens durchgeführt und ausführlich dokumentiert werden.
Was ist das Interessenbekundungsverfahren (IBV)?
Das Interessenbekundungsverfahren hat vielerlei Bedeutungen, weshalb hierbei die Verbindung zur Markterkundung deutlich werden muss. Es beschreibt zum einen ein formloses Verfahren zur Markterkundung, bei dem Konzeptvorschläge oder Lösungen von Interessenten vorgestellt werden. Hierbei ist eine Belehrung essentiell, bei der hervortritt, dass es sich um keine Beschaffungsabsicht handelt, sondern lediglich um eine Marktanalyse.
Zum anderen bedeutet das IBV, dass öffentliche Auftraggeber in Erwägung ziehen, künftige Aufgaben durch Private erfüllen zu lassen. Daher wird den privaten Anbietern die Möglichkeit gegeben, darzulegen, ob und inwieweit sie staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten ebenso gut oder besser erbringen können, als die öffentliche Hand selber.
Was ist eine Direktvergabe und wann darf sie angewendet werden?
Bei der Direktvergabe wird ausschließlich mit nur einem Bieter verhandelt, was bedeutet, dass kein Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird. Daher ist es hierbei umso wichtiger, gute Gründe für eine Vergabe vorweisen zu können. Es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten, bei denen eine Direktvergabe empfohlen wird oder gar notwendig ist. Wird beispielsweise kein geeignetes Angebot in einem Verfahren abgegeben oder werden die Anforderungen des Auftraggebers nicht erfüllt, kann die Auftragsvergabe im Wege einer Direktvergabe durchgeführt werden. Das Gleiche gilt für Dringlichkeitsvergaben, für Lieferleistungen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken sowie für Aufträge, welche zu unverhältnismäßigen Schwierigkeiten führen können (z.B. bei dem Kauf von unterschiedlichen technischen Merkmalen). Ein weiterer Grund könnte entstehen, wenn nur ein einziges Unternehmen den Auftrag erfüllen kann (z.B. einzigartiges Kunstwerk).
Grundsätzlich sollte man bei einer Direktvergabe immer auf genug Belege für die Ausnahmesituation und eine ausführliche Dokumentation achten. Eine unrechtmäßig durchgeführte Direktvergabe gilt es zu vermeiden. Ist dies jedoch der Fall, muss ggf. mit Schadenersatzforderungen gerechnet werden.
Wie gleiche ich einen Wettbewerbsvorteil aus?
Einem Auftraggeber wird es freigestellt, wie er sich einen Marktüberblick verschafft. Informationen können zum Beispiel über Unternehmen eingeholt oder im Internet recherchiert werden. Dabei ist es wichtig, nicht gegen den Wettbewerbsgrundsatz zu verstoßen. Denn der Wettbewerbsgrundsatz sagt aus, dass ein fairer Markt nur mit Chancengleichheit bestehen kann und dabei der Beschaffungsvorgang unvoreingenommen und von Verfälschung befreit sein soll. Erhält ein Unternehmen aufgrund der Markterkundung vor dem Vergabeverfahren gewollt oder ungewollt Sonderwissen, müssen vom Auftraggeber entsprechende Ausgleichsmaßnahmen eingeleitet werden. Um diese Vorteile auszugleichen, gibt es einige Möglichkeiten. Zum Beispiel können die Ergebnisse und deren Weg dorthin für alle potentiellen Bieter offenbart werden und die Angebotsfrist entsprechend verlängert werden. Ebenso sollten die Gesprächsinhalte zwischen den jeweiligen Unternehmen und dem Auftraggeber umfassend dokumentiert werden. Wenn diese Informationen im Vergabeverfahren offengelegt werden, kann man nicht mehr von einem Vorsprung eines Unternehmens reden. Sofern sämtliche Ausgleichmöglichkeiten scheitern, kann das vorbefasste Unternehmen als ultima ratio vom Vergabeverfahren ausgenommen werden.
Markterkundung – Vergaberechtslexikon
Hinweis: Dieser Rechtstipp ersetzt keinen anwaltlichen Rat im Einzelfall. Er ist naturgemäß unvollständig, auch ist er nicht auf Ihren Fall bezogen und stellt zudem eine Momentaufnahme dar, da sich gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung im Lauf der Zeit ändern. Er kann und will nicht alle denkbaren Konstellationen abdecken, dient Unterhaltungs- und Erstorientierungszwecken und soll Sie zur frühzeitigen Abklärung von Rechtsfragen motivieren, nicht aber davon abhalten.