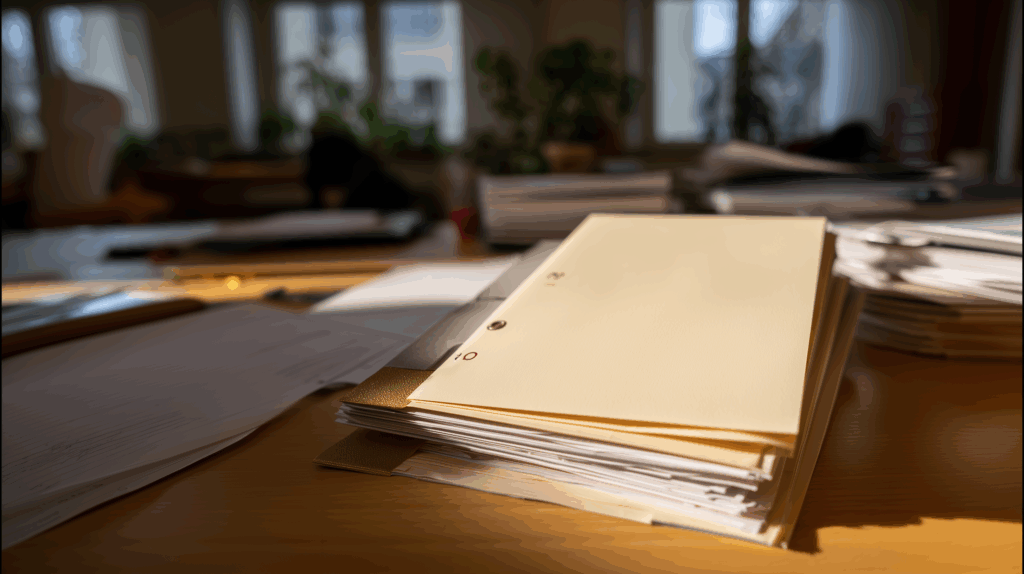Unsere Rechtsanwältin Anne Grahl hat sich am 13.06.2025 in einem abante live zum Vergaberecht mit dem Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 07. Mai 2025 (Az.: Verg 8/24) befasst.
Das Bayerische Oberste Landesgericht hat eine aufschlussreiche Entscheidung getroffen, die ein häufig diskutiertes Thema im Vergaberecht in den Fokus rückt: die Anforderungen an die Bewertung qualitativer Zuschlagskriterien. Der Beschluss macht deutlich, dass Bewertungsentscheidungen im Vergabeverfahren nicht frei nach Belieben erfolgen dürfen, sondern rechtsstaatlichen Anforderungen unterliegen – insbesondere dem Transparenzgebot, der Gleichbehandlung der Bieter und dem Gebot der Nachvollziehbarkeit. Dies gilt auch in Bereichen, in denen funktionale Ausschreibungen kreative Lösungen erfordern und der Auftraggeber über einen Beurteilungsspielraum verfügt. Besonders hervorgehoben wird die Pflicht zur nachvollziehbaren Dokumentation der Wertung. Fehlt diese, kann das Vergabeverfahren angreifbar sein.
Hier gelangen Sie zum Video der Besprechung dieser Entscheidung:
Ausgangslage
Das Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) vom 13. Juni 2025 betrifft ein europaweites Vergabeverfahren eines öffentlich getragenen Klinikums. Gegenstand war die Vergabe eines Auftrags zur Erbringung zentraler Beschaffungsdienstleistungen durch eine Einkaufsgemeinschaft, die unter anderem Rahmenverträge schließen, Produkte auswählen, Einsparpotenziale identifizieren und strategische Versorgungsstrukturen unterstützen sollte.
Die Ausschreibung erfolgte im offenen Verfahren. Die Zuschlagskriterien gliederten sich in einen Preisanteil (30 %) sowie in die Bewertung mehrerer qualitativer Konzepte (70 %). Bewertet wurden unter anderem Rückvergütungsmodelle, Digitalisierung, Innovationsfähigkeit, Netzwerkbildung, Weiterbildungskonzepte sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit.
Zwei Einkaufsgemeinschaften reichten innerhalb der Angebotsfrist vollständige Angebote ein. Während die Antragstellerin im Preiskriterium besonders günstig abschnitt, erzielte die Beigeladene aufgrund der konzeptionellen Bewertung die höhere Gesamtpunktzahl. Die Antragstellerin rügte diese Entscheidung mit Verweis auf schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei der Wertung ihrer Konzepte. Sie beanstandete insbesondere eine fehlende Nachvollziehbarkeit, sachwidrige Erwägungen sowie einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot. Der Nachprüfungsantrag führte zur teilweisen Aufhebung der Zuschlagsentscheidung durch die Vergabekammer Ansbach (Az. RMF‑SG21‑3194‑9‑32). Das Klinikum reichte gegen die Entscheidung der Vergabekammer Beschwerde ein, die Antragstellerin legte hierauf ebenfalls Anschlussbeschwerde ein, da die Vergabekammer über zwei weitere Konzeptbewertungen keine Entscheidung getroffen habe, woraufhin das BayObLG (Az. Verg 8/24 e) mit dem Fall befasst wurde.
Entscheidung des Gerichts
Der Beschluss des BayObLG stellt klar, dass qualitative Zuschlagskriterien keinen rechtsfreien Raum eröffnen. Auch dort, wo kreative, konzeptionelle oder strategische Beiträge gefordert sind, müssen Bewertungen transparent, konsistent und auf sachlich tragfähigen Erwägungen beruhen. Ein weiter Beurteilungsspielraum entbindet die Vergabestelle nicht von ihrer Pflicht zur Einhaltung vergaberechtlicher Grundprinzipien.
Besonders deutlich wurde dies beim Bewertungskriterium „Rückvergütung“: Die Vergabestelle hatte in der Bewertungsmatrix definiert, dass eine zeitnahe Rückvergütung positiv zu bewerten sei – ein Aspekt, den das Angebot der Antragstellerin vollständig erfüllte. Dennoch erhielt die Antragstellerin in diesem Punkt eine niedrigere Bewertung, ohne dass dies nachvollziehbar dokumentiert wurde. Das Gericht bewertete dies als eindeutigen Bruch mit den selbst gesetzten Wertungsvorgaben.
Zudem monierte der Beschluss, dass teils Aspekte in die Bewertung eingeflossen seien, die nicht in den Ausschreibungsunterlagen als Anforderungen bekannt gemacht worden waren. In anderen Fällen wurden inhaltlich zutreffende Angaben der Antragstellerin abgewertet, obwohl sie objektiv die geforderten Inhalte erfüllten – etwa im Bereich der Digitalisierung, der Weiterbildung sowie der Planung zur Absicherung von Lieferketten in Krisensituationen.
Das BayObLG betonte, dass eine vergleichende Bewertung nicht zu unterschiedlichen Punktvergaben führen darf, wenn die inhaltlichen Leistungen gleichwertig sind. Eine sachlich nicht begründete Abweichung verletzt die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung. Die Vergabestelle wurde daher verpflichtet, das Vergabeverfahren in den Stand vor der Wertung der Angebote zurückzuversetzen und die Konzepte Nr. 1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.7, 3.8, 4, 5 sowie 6.1 und 6.2 vollständig neu zu bewerten. Das Verfahren war sodann unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts fortzuführen.
Rechtmäßigkeit der Bewertung
Das BayObLG stellte fest, dass die Angebotswertung in mehreren zentralen Punkten vergaberechtswidrig war. Insbesondere die Abweichung von den eigenen Bewertungsvorgaben sowie die unzureichende Dokumentation führten zur Beanstandung. Der Senat betonte, dass eine konsistente und nachvollziehbare Bewertung keine bloße Formalie ist, sondern eine rechtlich gebotene Voraussetzung für ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren – gerade bei der Bewertung qualitativer Zuschlagskriterien.
Fazit
Die Entscheidung des BayObLG verdeutlicht die hohe Bedeutung einer strukturierten und rechtssicheren Bewertungsmethodik – gerade bei Ausschreibungen, in denen qualitative Konzepte maßgeblich sind. Öffentliche Auftraggeber müssen sich an die selbst gesetzten Bewertungsmaßstäbe halten und diese konsistent anwenden. Eine abweichende Bewertung gleichwertiger Inhalte ohne sachliche Begründung ist unzulässig.
Darüber hinaus muss jede Bewertung ausreichend dokumentiert werden. Die Dokumentation ist nicht nur intern bedeutsam, sondern bildet im Streitfall die zentrale Grundlage für eine gerichtsfeste Nachvollziehbarkeit. Wo der qualitative Anteil hoch ist, steigt das Risiko subjektiver Fehlbewertungen – umso wichtiger sind strukturierte Prozesse und gegebenenfalls externe Begleitung zur Qualitätssicherung.
Hinweise für öffentliche Auftraggeber
Die Entscheidung verdeutlicht die rechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung und Durchführung von Bewertungsverfahren im Rahmen funktionaler Ausschreibungen:
Verbindlichkeit der Bewertungsmaßstäbe
Im Rahmen funktionaler Ausschreibungen sind die von der Vergabestelle selbst gesetzten Bewertungsmaßstäbe – etwa in einer Wertungsmatrix – verbindlich. Werden diese Maßstäbe im Nachgang relativiert oder durch nicht kommunizierte Kriterien ersetzt, verstößt dies gegen die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung. Die Vergabestelle ist an ihre eigenen Vorgaben gebunden und darf diese nicht willkürlich ändern.
Notwendigkeit von Konsistenz in der Bewertung
Vergleichbare Leistungen müssen im Bewertungsverfahren auch vergleichbar behandelt werden. Weichen Bewertungen voneinander ab, obwohl sich die Angebote hinsichtlich der relevanten Merkmale nicht unterscheiden, so muss dies fachlich fundiert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Eine konsistente Bewertungspraxis schützt vor Willkür und sichert die Gleichbehandlung aller Bieter.
Dokumentation als rechtliche Pflicht
Die Dokumentation des Bewertungsverfahrens ist keine freiwillige Maßnahme, sondern eine rechtlich zwingende Anforderung – insbesondere bei der Bewertung qualitativer Kriterien. Da solche Wertungen häufig einzelfallbezogen und ermessensgeleitet sind, müssen die Bewertungsgrundlagen und die Vergabe von Punktwerten ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert werden. Dies ergibt sich auch aus § 8 VgV, der eine umfassende Dokumentation verlangt.
Nachvollziehbarkeit für Dritte sicherstellen
Die Nachvollziehbarkeit der Bewertung ist nicht nur für unterlegene Bieter von Bedeutung, sondern auch für die Instanzen, die in einem möglichen Nachprüfungsverfahren mit der Überprüfung des Vergabeverfahrens befasst sind. Pauschale Aussagen oder formelhafte Begründungen reichen nicht aus. Vielmehr bedarf es konkreter und transparenter Darlegungen der Entscheidungsgrundlagen.
Stärkung der internen Qualitätssicherung
Bei Ausschreibungen, in denen qualitative Kriterien eine zentrale Rolle spielen, sollte die Vergabestelle ihre internen Bewertungsprozesse kritisch hinterfragen. Eine strukturierte Qualitätssicherung kann helfen, Bewertungsfehler zu vermeiden. Gegebenenfalls kann auch eine externe Begleitung sinnvoll sein, um die Objektivität und Belastbarkeit der Bewertungen zu erhöhen.
Hinweise für Bieter
Auch für Bieter und Zuwendungsempfänger enthält die Entscheidung wertvolle Hinweise zur strategischen Positionierung im Vergabeverfahren:
Frühzeitig rügen, um Rechte zu sichern
Bieter sollten bei ersten Anzeichen von Unstimmigkeiten in der Vorabinformation sorgfältig prüfen, ob eine Rüge geboten ist. Auch wenn konkrete Bewertungsfehler zu diesem Zeitpunkt oft noch nicht erkennbar sind, kann es ausreichen, auf eine unzureichende oder unklare Begründung hinzuweisen. Voraussetzung ist, dass die Rüge den erkennbaren Gehalt der Beanstandung erkennen lässt. Eine frühzeitige, sachlich begründete Rüge kann entscheidend dafür sein, später Zugang zum Nachprüfungsverfahren zu erhalten – wildes oder pauschales Rügen sollte indes vermieden werden.
Gezielte Nutzung der Akteneinsicht
Der Beschluss stellt klar, dass Informationen, die erst im Rahmen der Akteneinsicht bekannt werden, nachträglich in ein Nachprüfungsverfahren eingebracht werden dürfen. Dadurch können Bieter ihre Beanstandungen auf eine fundierte Grundlage stützen und das weitere Vorgehen gezielt ausrichten – ohne Gefahr der Präklusion, sofern die ursprüngliche Rüge die Informationslage zutreffend widerspiegelt.
Konzeptdarstellung mit Präzision
Zwar äußert sich der Beschluss nicht ausdrücklich zur Form der Konzeptdarstellung. Gleichwohl zeigt das Verfahren, dass eine klare und strukturierte Ausarbeitung gerade bei funktionalen Ausschreibungen mit Bewertungsspielraum hilfreich sein kann – sowohl für die Verständlichkeit der Bewertung als auch für deren rechtliche Nachvollziehbarkeit im Nachprüfungsverfahren.
Gleichbehandlung einfordern
Sollten Inhalte mit vergleichbarem Wert unterschiedlich bewertet worden sein, ist es ratsam, dies kritisch zu hinterfragen. Die Maßstäbe der Gleichbehandlung gelten auch für qualitative Wertungen. Ohne eine schlüssige und dokumentierte Begründung darf eine differenzierende Bewertung nicht akzeptiert werden.