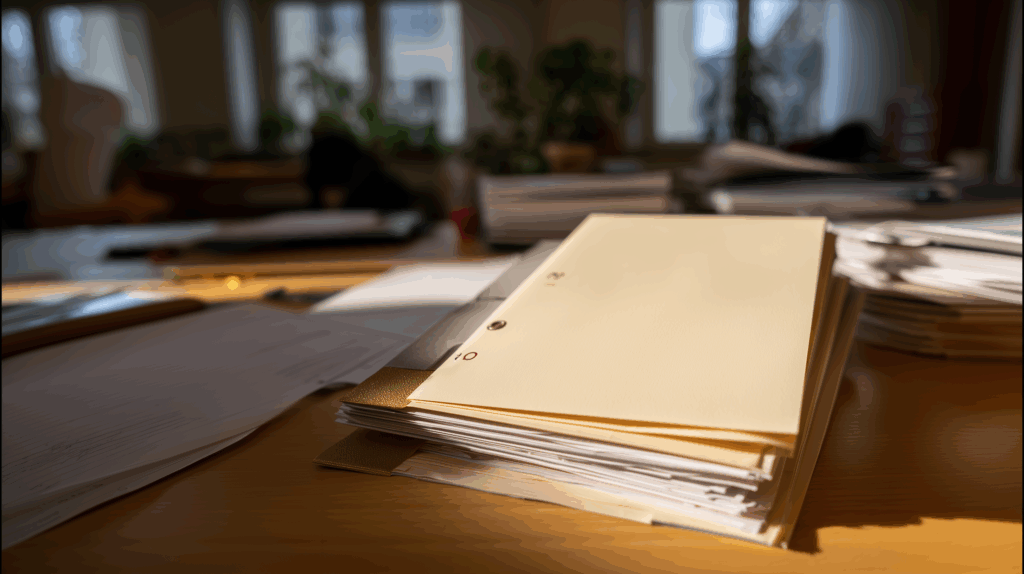Im Zentrum der EuGH-Entscheidung (Rs. C‑266/22) steht ein Vergabeverfahren über ein Eisenbahninfrastrukturprojekt in Kroatien mit einem Volumen von rund 200 Millionen Euro. Teilgenommen hatte auch ein türkisches Bauunternehmen – also ein Bieter aus einem Drittstaat ohne GPA-Mitgliedschaft.
Nachdem der Zuschlag an ein anderes Unternehmen ging, machte das türkische Unternehmen geltend, es sei bei der Prüfung der Eignungsnachweise ungleich behandelt worden. Die Klage bezog sich auf die EU-Sektorenvergaberichtlinie 2014/25. Das zuständige kroatische Gericht legte dem EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens mehrere Fragen zur Auslegung dieser Richtlinie vor – insbesondere zur Zulässigkeit nationaler Regelungen über den Zugang von Drittstaaten-Unternehmen zu öffentlichen Vergabeverfahren.
Die Entscheidungsbesprechung von unserem Rechtsanwalt Achim Wiesmann im Video:
Kernpunkt der Entscheidung: Keine Rechte aus EU-Richtlinien für Drittstaaten-Unternehmen
Der EuGH entschied, dass die Sektorenvergaberichtlinie keine Rechte für Unternehmen aus Drittstaaten begründet – es sei denn, diese Drittstaaten sind dem GPA (Government Procurement Agreement) beigetreten oder haben ein entsprechendes bilaterales Abkommen mit der EU geschlossen.
Im vorliegenden Fall traf dies auf die Türkei nicht zu. Der EuGH stellte zudem klar: Nationale Gesetzgeber dürfen weder eigenständig Rechte für Drittstaaten-Unternehmen schaffen noch deren Ausschluss normativ anordnen – denn die Handelspolitik liegt ausschließlich in der Zuständigkeit der EU.
Ein öffentlicher Auftraggeber darf Drittstaaten-Bieter im Einzelfall zulassen oder ausschließen. Diese Entscheidung muss jedoch individuell im jeweiligen Verfahren getroffen werden. Ein generelles gesetzliches Verbot oder Gebot verstößt gegen EU-Recht.
Tipps für öffentliche Auftraggeber: Entscheidungsfreiheit, aber kein Freifahrtschein
- Prüfpflicht statt Automatismus: Auftraggeber müssen den Zugang von Drittstaaten-Bietern im Einzelfall bewerten – pauschale nationale Ausschlüsse sind unzulässig.
- Kein Rechtsanspruch auf Teilnahme: Drittstaaten-Unternehmen haben kein subjektives Recht auf Gleichbehandlung im Sinne der EU-Vergaberichtlinien.
- Transparente Dokumentation: Wird ein Drittstaaten-Bieter zugelassen oder ausgeschlossen, sollte die Entscheidung im Vergabevermerk gut dokumentiert werden.
- Achtung bei nationalen Regelungen: Gesetzliche Vorgaben, die ohne EU-Ermächtigung den Zugang beschränken oder vorschreiben, sind oft rechtswidrig.
Tipps für Bieter und Zuwendungsempfänger: Beteiligung möglich – aber rechtlich sensibel
- Einzelfallprüfung beachten: Die Teilnahme von Drittstaaten-Bietern ist zulässig, aber nicht garantiert. Sie erfolgt auf Entscheidung des jeweiligen Auftraggebers.
- Keine Berufung auf EU-Recht: Unternehmen aus Drittstaaten können sich nicht auf die EU-Vergaberichtlinien berufen – weder zur Teilnahme noch im Nachprüfungsverfahren.
- Rechtsbehelf? Nur eingeschränkt: Ein Drittstaaten-Bieter kann allenfalls auf Basis nationalen Rechts eine Rüge erheben – und auch das nur dann, wenn dieses Recht nicht der Umsetzung von EU-Recht dient.
- Formale Präsenz zählt: Tochtergesellschaften in der EU gelten in der Regel als inländische Unternehmen – der Sitz ist entscheidend, nicht die Konzernstruktur.