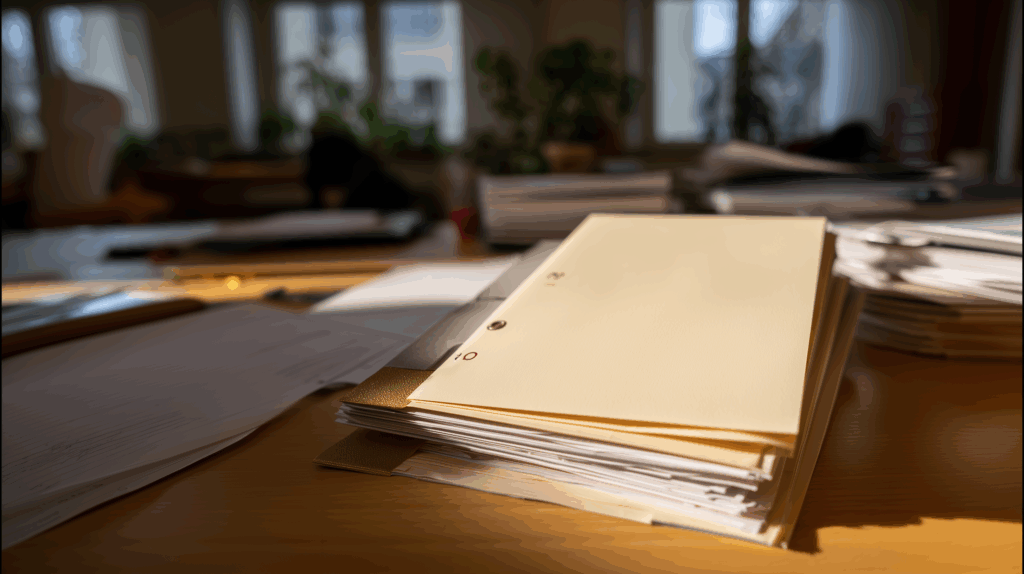Unsere Autoren

- Fachanwalt für Vergaberecht
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht
- Fachanwalt für Medizinrecht

- Rechtsanwalt
Das Problem: die Beteiligung von Bietern aus Drittstaaten in Vergabeverfahren
Das Thema der Beteiligung von Wirtschaftsteilnehmern aus sog. Drittstaaten an Vergabeverfahren und Vergabenachprüfungsverfahren ist infolge zweier jüngerer Urteile des europäischen Gerichtshofs zu einer der aktuell meistdiskutierten vergaberechtlichen Fragen avanciert. Mit Drittstaaten in diesem Sinne sind Herkunftsländer gemeint, die weder Mitglied der Europäischen Union sind noch zu den Vertragsparteien des internationalen Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement Agreement – GPA) oder anderer bilateraler Abkommen gehören, an welche die EU gebunden ist (dazu gehören der Europäische Wirtschaftsraum (EWR), diverse Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit Beitrittsländern und andere internationale Abkommen mit Verpflichtungen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens).
Zwei Entscheidungen des EuGH
Der EuGH hat sich zuerst mit Urteil vom 22.10.2024 (Rechtssache C‑652/22 – Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret) und dann kurz darauf erneut in einem ähnlichen Sachverhalt mit Urteil vom 13.03.2025 (Rechtssache C‑266/22 – CRRC Qingdao Sifang) damit befasst, ob ein Bieter aus einem solchen Drittstaat – in dem einen Verfahren ging es um ein Unternehmen aus der Türkei; in dem anderen um eine Bietergemeinschaft mit dem verantwortlichen Mitglied aus China – zulässigerweise von einem europaweiten Vergabeverfahren ausgeschlossen werden darf und inwieweit einem solchen Unternehmen der reguläre Vergaberechtsschutz eröffnet ist.
Der Gerichtshof gelangte in diesen beiden Rechtssachen zu dem Befund, dass sich Bieter und Bewerber aus Drittstaaten bei der Teilnahme an EU-Vergabeverfahren weder auf europäische noch auf nationale Vorschriften, die zur Umsetzung des europäischen Vergaberechts erlassen wurden, berufen können und es ihnen verwehrt ist, sich zur Geltendmachung vermeintlicher Vergaberechtsverstöße des öffentlichen Auftraggebers eines Vergabenachprüfungsverfahrens zu bedienen. Die EU-Mitgliedstaaten sind ferner nicht befugt, diesbezüglich gesetzgeberisch tätig zu werden oder verbindliche Regeln über den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten zu erlassen – allein die Union hätte hierzu die Kompetenz. Da die EU hierzu bislang keine Rechtsakte erlassen hat, die seitens der Mitgliedstaaten diesbezüglich ausgeführt werden könnten, verbleibe es daher einstweilen bei der Beurteilungs- und Entscheidungsbefugnis der öffentlichen Auftraggeber über den Zugang solcher Unternehmen. Demgemäß können öffentliche Auftraggeber in Vergabeunterlagen Maßgaben aufstellen, mit denen über die generelle Zulassung von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten in europaweiten Vergabeverfahren entschieden wird und anhand derer im Fall einer Beteiligung ggf. eine Bewertungsanpassung ihrer Angebote im Vergleich zu EU/GPA-Bietern erfolgt.
Kehrtwende: Sonderregelungen für Drittstaatsbieter zulässig
Diese vielbeachteten Entscheidungen des EuGH sind von hoher Praxisrelevanz, da sie eine Kehrtwende der nationalen Vergaberechtsprechung bedingen, die bislang einer unterschiedlichen Behandlung von Bietern aus Drittstaaten in Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich eine Absage erteilt hat (so beispielsweise OLG Düsseldorf, Beschl. v. 01.12.2021, VII-Verg 53/20, VII-Verg 54/20 und VII-Verg 55/20). Zudem hat auch der Gerichtshof in seinen Urteilen naturgemäß nicht alle in der Praxis mit einer Involvierung von Unternehmen aus Drittstaaten verbundenen Fragen ansprechen und beantworten können.
Non-Paper der EU-Kommission
Vor diesem Hintergrund hat sich nun die Europäische Kommission dieses Themenkreises und einer Vielzahl damit verbundener offener Fragen angenommen und im Mai 2025 ein „Non-Paper“ betreffend die Teilnahme von Bieter aus Drittländern am EU-Beschaffungsmarkt veröffentlicht (GROW/E2-JPZ/CM-Ares(2025)… 22/05/2025, abrufbar unter: https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/0e5f20cf-6e13-42e6-a132-7a78488ef6cb/download). Bei einem solchen „Non-Paper“ handelt es sich um ein informelles Dokument ohne Rechtskraft, mit dem üblicherweise bestimmte Rechtspositionen und Lösungsansätze einer breiteren Öffentlichkeit zu Sondierungszwecken präsentiert werden, bevor danach durch die Kommission ggf. unter Berücksichtigung der ergangenen Reaktionen bestimmte Punkte in offizielle Dokumente oder Rechtsakte überführt werden.
In dem Dokument gibt die Kommission eine Reihe interessanter Hinweise, die teils weit über die eigentlichen Entscheidungsbegründungen des EuGH hinausgehen. Dazu gehören die folgenden Aussagen:
- In Bezug auf Wirtschaftsteilnehmer aus Drittstaaten steht es im Ermessen jedes öffentlichen Auftraggebers entweder von Fall zu Fall oder nach einem unverbindlichen einheitlichen Ansatz zu entscheiden, ob bzw. nach welchen Kriterien diese Bieter bzw. Bewerber zum Vergabeverfahren zugelassen werden oder nicht.
- Dasselbe gilt grundsätzlich für Bietergemeinschaften und Bietergemeinschaftsmitglieder aus Drittstaaten sowie für Unterauftragnehmer und eignungsleihende Unternehmen aus Drittstaaten.
- Zu diesem Ermessen des öffentlichen Auftraggebers kann auch die Entscheidung gehören, keinen Unterschied zwischen Angeboten von Wirtschaftsteilnehmern aus dem EU-Inland und Drittstaaten zu machen.
- Auch in so einem Fall bleibt es allerdings dabei, dass Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten eine Geltendmachung der Verletzung nationaler Vergabevorschriften, die auf dem EU-Vergaberecht beruhen, im Wege des Nachprüfungsverfahrens nicht möglich ist. Denn ihnen stehen keine Rechte zu, die sich aus dem EU-Vergaberecht ableiten, einschließlich der im EU-Recht verankerten Grundsätze der Transparenz und Verhältnismäßigkeit sowie des Vergaberechtsmittelsystems.
- Etwas anderes kann im Einzelfall im Hinblick auf die Geltendmachung von Rechten durch Bieter und Bewerber aus Drittstaaten gelten, die sich nicht aus dem EU-Vergaberecht ergeben, sondern beispielsweise aus nationalem Vertragsrecht, und die den Zugang zu einem nationalen zivil- oder verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelf ermöglichen, der nicht in Zusammenhang mit den EU-Vergaberichtlinien steht.
- Der öffentliche Auftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen angeben, ob die Teilnahme von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten zugelassen wird oder nicht und welche Regelungen im Fall der Zulassung für diese Angebote gelten. Der Auftraggeber kann aber auch beschließen, das nicht im Voraus bekanntzugeben und hat dann zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens die Möglichkeit, das Angebot eines Bieters aus einem Drittstaat anzunehmen oder abzulehnen.
- Sollten Angebote von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten zugelassen werden, kann der öffentliche Auftraggeber in den Vergabeunterlagen Maßgaben über eine Bewertungsanpassung dieser Angebote aufstellen. Dieser Anpassungsmechanismus könnte sich an den Bestimmungen von Art. 6 Abs. 8 der Verordnung (EU) 2022/1031 über das Internationale Beschaffungsinstrument (International Procurement Instrument – IPI) orientieren. Es kann aber auch ein beliebig anderer Anpassungsmechanismus gewählt werden.
- Im Hinblick auf von Bietern angebotene Waren mit Ursprung aus Drittstaaten gelten ggf. besondere Regeln (siehe Art. 85 Abs. 2 SektorenRL, § 55 Abs. 1 SektVO).
- Sollten nationale Rechtsvorschriften eines EU-Mitgliedstaats Bestimmungen über den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten enthalten, so sind diese Vorschriften nicht anzuwenden und entsprechend zu ändern, da in diesem Bereich eine ausschließliche Regelungskompetenz der EU besteht.
- Die beiden Entscheidungen des EuGH sind in Ansehung der Handelspolitik der EU ergangen, die nicht an einen Schwellenwert oder ein grenzüberschreitendes Interesse gebunden ist, weshalb deren Aussagen für jedes Vergabeverfahren unabhängig von den EU-Schwellenwerten und dem Wert des Angebots gelten.
Hinweise für Auftraggeber:
Die Kommission hat in der Mitteilung ausdrücklich klargestellt, dass es in der Verantwortung des öffentlichen Auftraggebers liegt, festzustellen, ob es neben den auf europäischen Vorgaben basierenden Vergaberechtsnormen noch nationale Vorschriften gibt, die den Zugang von Bietern aus Drittstaaten bei der Teilnahme an Vergabeverfahren regeln bzw. das Verhalten des Auftraggebers zu solchen Vorgaben festlegen. Diese könnten sich etwa aus haushaltsrechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit oder aus zuwendungs- bzw. fördermittelrechtlichen Vorgaben ergeben.
Auftraggeber sollten sich zunächst fragen, welche Relevanz die oben vorgestellte Rechtsprechung für ihre Beschaffungspraxis überhaupt hat. Dies kann nur in Abhängigkeit vom konkreten Vorhaben beantwortet werden. Vor allem in Bau- und Infrastrukturvergaben, aber auch in der Fahrzeug- und IT-Beschaffung kann es zu einer Beteiligung von Drittstaatsbietern kommen. In der Vergabe von Planungs‑, Security- und Reinigungsleistungen etwa erscheint dies als eher unwahrscheinlich.
Wenn die relevanten Beschaffungsgegenstände identifiziert wurden, kann es sinnvoll sein, in Ruhe zu überlegen, auf welche Weise eine Beteiligung erfolgen wird, und ob sie grundsätzlich vielleicht sogar erwünscht ist. Hierauf abgestimmt sollte der Auftraggeber Sonderregelungen in seine Bewerbungsbedingungen aufnehmen, wobei er sich – zur Meidung von Schadensersatzansprüchen – vom Prinzip der Vollständigkeit, Klarheit und Wahrheit leiten lassen sollte. Er sollte ausführlich, zutreffend und in klarer Sprache darüber unterrichten, wie er Unternehmen behandeln wird, die aus Drittstaaten kommen bzw. mit Drittstaatsunternehmen zusammenarbeiten.
Hinweise für Bieter
Deutsche Bieter sollten sich sehr genau überlegen, ob und in welchem Umfang sie mit Drittstaatsunternehmen zusammenarbeiten. Denkbar ist, dass bereits die Nachunternehmer- oder sogar bloß die Lieferanten-Stellung des Drittstaatsunternehmen schädlich für den Erfolg im Vergabeverfahren ist. Ein Ausschluss aus dem Vergabeverfahren, nur weil man ein Unternehmen aus einem Drittstaat einbezogen hat – das ist mehr als ärgerlich.
Drittstaatenunternehmen wiederum sollten die vorstehend dargelegte Entwicklung nicht dahingehend missverstehen, dass ihnen von nun an jeglicher Rechtsschutz abgeschnitten ist. Das mag für den Rechtsweg zu den Vergabekammern zutreffen, aber Rechtsschutz vor den Zivilgerichten kommt weiterhin in Betracht. Allerdings kann es im Einzelfall anspruchsvoll werden, die Rechtspositionen zu identifizieren, die dort geltend gemacht werden können.
Wie auch immer die rechtliche Risikobewertung ausfällt, sie ist in einem zweiten Schritt möglichst strukturiert umzusetzen bzw. abzusichern, und zwar nicht nur in anstehenden Vergabeverfahren, sondern auch in Nachunternehmer- und Lieferantenverträgen mit Drittstaatsunternehmen.
Sprechen Sie uns an! Die Anwälte bei abante haben Erfahrungen mit Drittstaatsbietern in Vergabeverfahren.